Der BVSW veranstaltet regelmäßig regionale Sicherheitskreise (Süd, Ost, Nord), um unsere Mitgliedsunternehmen bei sicherheitsrelevanten Fragestellungen gezielt zu unterstützen und den Austausch zu fördern.
Aktuell steht mit dem Operationsplan Deutschland ein Thema im Fokus, das bundesweit hohe Relevanz hat. Aus diesem Anlass bieten wir erstmals ein überregionales Format an, das sich an alle Mitglieder unserer Sicherheitskreise in ganz Bayern richtet – unabhängig von ihrer jeweiligen Region.
Der Operationsplan Deutschland regelt die militärische Landesverteidigung im Verteidigungsfall. Er beschreibt unter anderem, wie Unternehmen in Krisensituationen die Bundeswehr unterstützen sollen. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit diesen Anforderungen ist entscheidend, um vorbereitet zu sein und die eigene Resilienz zu stärken.
Die zivil-militärische Zusammenarbeit wird in jedem Bundesland von den jeweiligen Landeskommandos koordiniert. In Bayern übernimmt diese zentrale Schnittstellenfunktion das Landeskommando Bayern.
Um Ihnen fundierte Einblicke und konkrete Handlungsempfehlungen zu ermöglichen, haben wir ausgewählte Expertinnen und Experten eingeladen. Sie werden uns über die aktuellen Rahmenbedingungen informieren, mit uns in den Dialog treten und Ihre individuellen Fragen beantworten.
Mit diesem besonderen überregionalen Angebot möchten wir allen Mitgliedsunternehmen unserer Sicherheitskreise die Möglichkeit geben, sich umfassend über ihre Rolle im Rahmen des Operationsplans zu informieren und sich aktiv in den Austausch einzubringen.
Weitere Informationen folgen in Kürze.
PRESSEMITTEILUNG
Aying, 30.06.2025 – Der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW) hat am 30. Juni 2025 im Rahmen seiner jährlichen Mitgliederversammlung wichtige personelle Weichen gestellt und aktuelle sicherheitspolitische Entwicklungen diskutiert.
Präsident des LfV Bayern informiert zur aktuellen Bedrohungslage
Zu Beginn der Veranstaltung stellte sich der neue Präsident des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz, Manfred Hauser, erstmals offiziell den Mitgliedern des BVSW vor. In seinem Lagebericht betonte Hauser die zunehmende Bedrohung durch Extremismus jeglicher Ausprägung sowie durch hybride Einflussoperationen, insbesondere aus dem russischen Raum. Er unterstrich die Bedeutung einer engen Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft und bot der bayerischen Wirtschaft ausdrücklich an, sich bei sicherheitsrelevanten Anliegen direkt an das LfV Bayern zu wenden.
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024: Verband wirtschaftlich gut aufgestellt
Im Anschluss präsentierte Caroline Eder, Geschäftsführerin des BVSW, den Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2024. Sie zeigte auf, dass sich der Verband wirtschaftlich und organisatorisch sehr positiv entwickelt hat. Das Geschäftsjahr wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Mitgliederversammlung entlastete daraufhin einstimmig Vorstand und Geschäftsführung.
Vorstandswahlen: Markus Klaedtke neuer Vorsitzender
Turnusgemäß standen in diesem Jahr Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Sämtliche bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Eine bedeutende Veränderung ergab sich an der Spitze des Gremiums: Der langjährige Vorsitzende Johannes Strümpfel stellte sich nicht erneut zur Wahl. Er ist seit Kurzem Präsident des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (VSW), dem auch der BVSW angehört.
Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde Markus Klaedtke einstimmig gewählt. Klaedtke ist Konzernsicherheitschef der Diehl-Gruppe und engagiert sich seit 1998 ehrenamtlich im Vorstand des BVSW. Zudem ist er Oberst der Reserve und Kommandeur des Regionalstabs Territoriale Aufgaben Nord im Landeskommando Bayern. Mit seiner langjährigen Erfahrung in Wirtschaft und Bundeswehr bringt Klaedtke umfassende sicherheitsstrategische Kompetenz in seine neue Funktion ein.
Ebenfalls gewählt wurden die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, die gemeinsam mit Markus Klaedtke den geschäftsführenden Vorstand des BVSW bilden:
- Holger Baierlein, stellvertretender CSO der Audi AG, übernimmt das Amt des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden.
- Stefan Rolf, Konzernsicherheitschef bei Rohde & Schwarz, wurde zum 2. Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Der BVSW dankt allen wiedergewählten Vorstandsmitgliedern für ihr erneutes Engagement und die Bereitschaft, das Ehrenamt mit Verantwortung und Weitblick auszuüben.
Über den BVSW
Der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft e. V. (BVSW) ist die zentrale Interessenvertretung der Sicherheit in der Wirtschaft in Bayern und ein wichtiger Partner für Behörden, Unternehmen und Institutionen in Fragen der Unternehmenssicherheit, Prävention und Zusammenarbeit.
Deutschland bereitet sich vor. Auf Szenarien, die wir uns alle nicht wünschen: großflächige Stromausfälle, Cyberangriffe, Naturkatastrophen oder militärische Eskalationen. Die Bundesrepublik denkt diese Risiken mit – und handelt. Doch die konkrete Vorbereitung geschieht überwiegend leise, unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle.
Der Begriff „Operationsplan Deutschland“ taucht mittlerweile in sicherheitspolitischen Debatten auf, ist aber für viele mit wenig greifbarem Inhalt gefüllt. Dabei betrifft er nahezu alle gesellschaftlichen Ebenen: Unternehmen, Einsatzkräfte – und letztlich die gesamte Bevölkerung.
Das Spannungsfeld ist klar: Einerseits müssen sicherheitsrelevante Informationen geschützt bleiben. Andererseits braucht es ein Mindestmaß an Transparenz und Kommunikation – denn Krisenvorsorge ist keine Aufgabe einzelner Behörden, sondern ein gesamtgesellschaftliches Projekt.
Vor diesem Hintergrund haben der ASW Bundesverband, der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW) sowie ASW Norddeutschland zentrale Informationen zum Operationsplan Deutschland strukturiert und aufbereitet. Ziel ist es, Orientierung zu bieten, Handlungsfähigkeit zu stärken – und Verantwortung zu teilen.
Die Sicherheitsverbände verstehen sich als Brückenbauer: zwischen Wirtschaft und Verwaltung, zwischen Unternehmen und Bundeswehr, zwischen abstrakter Strategie und konkreter Umsetzung.
Ein Plan kann nur dann Wirkung entfalten, wenn ihn die relevanten Akteure kennen und einordnen können. Darum wurde mit „[SICHER:] DAS MAGAZIN“ ein neues Informationsformat geschaffen, das regelmäßig Einblicke in sicherheitsrelevante Themen geben soll. Die erste Ausgabe wurde bereits veröffentlicht – mit Interviews, Reportagen und Beiträgen aus der Verbandsarbeit.
📄 Zur aktuellen Ausgabe von [SICHER:] DAS MAGAZIN gelangen Sie hier:
👉https://heyzine.com/flip-book/c85bd895a3.html
„[SICHER:] DAS MAGAZIN“ versteht sich als Plattform der Vernetzung. Als Ort des Dialogs. Und als Ausdruck eines klaren Gedankens: Sicherheit ist nicht Aufgabe weniger, sondern Verantwortung vieler.
Sie möchten sich aktiv einbringen, Themenvorschläge machen oder aus Ihrer Organisation berichten? Die Redaktion freut sich über Ihre Impulse und Ideen. Denn nur im gemeinsamen Dialog kann Vorbereitung zur gelebten Praxis werden.
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns über Ihr Interesse.
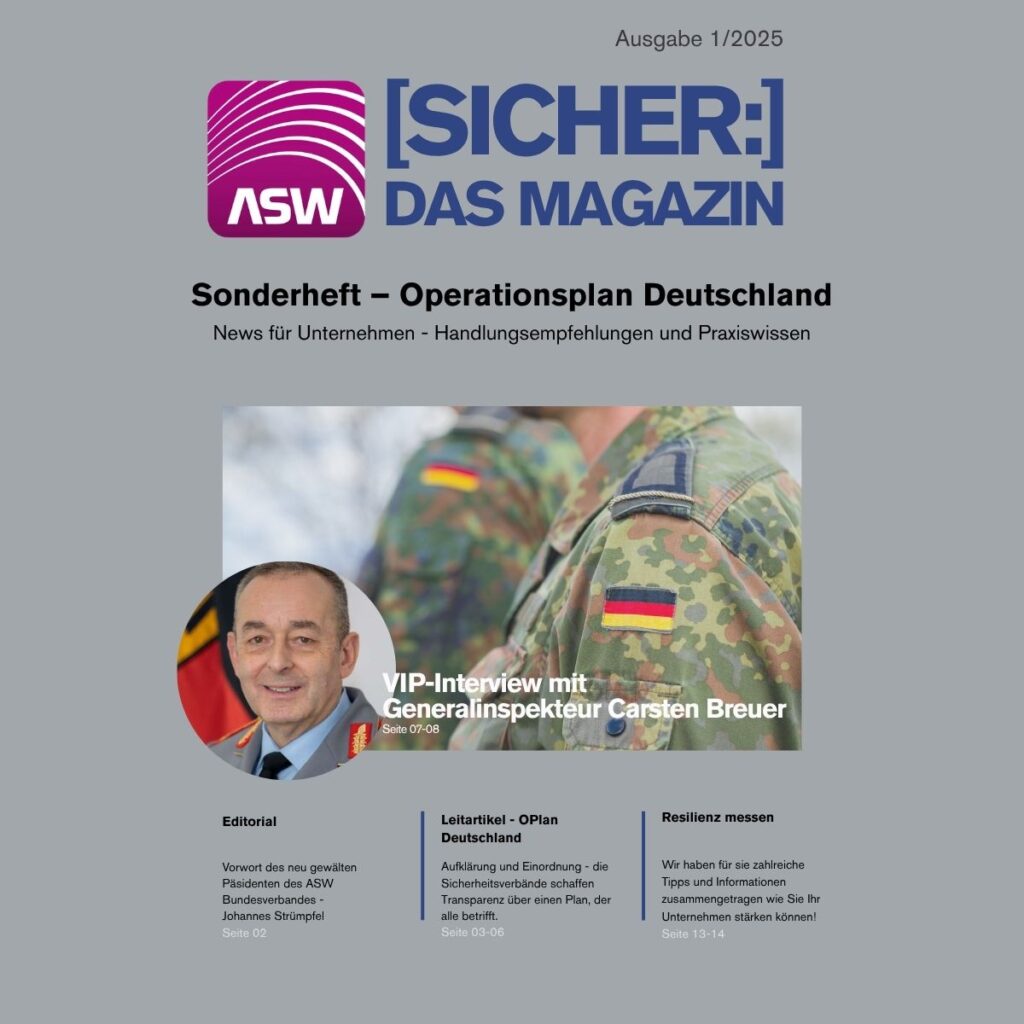
Der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW) und der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) sind mit einem gemeinsamen Messestand auf der SicherheitsExpo (25. und 26. Juni 2025) vertreten. Besucher können sich über die Arbeit der Verbände informieren und den Messestand auch für ihre geschäftlichen Meetings nutzen.
„Wir bieten auch dieses Jahr allen Besuchern eine zentrale Anlaufstelle, um direkt mit Vertreterinnen und Vertretern beider Organisationen ins Gespräch zu kommen“, erklärt Caroline Eder, Geschäftsführerin des BVSW. „Unser Stand steht ganz im Zeichen des Netzwerkgedankens. Mit dem gemeinsamen Messeauftritt möchten wir den Austausch innerhalb der Branche aktiv fördern und einen Einblick in die vielen Projekte geben, an denen die Sicherheitsverbände arbeiten. Auch für geschäftliche Meetings steht der Messestand allen offen.“
Ein zentrales Anliegen beider Verbände ist es, Unternehmen für aktuelle sicherheitsrelevante Entwicklungen zu sensibilisieren. Themen wie Cyberangriffe, der Schutz kritischer Infrastrukturen sowie die zunehmenden hybriden Bedrohungen stehen dabei besonders im Fokus. BVSW und BDSW wollen auch Impulsgeber für praktische Lösungen sein. Dafür informieren sie über neue Technologien, die sich in der Sicherheit nutzen lassen, ebenso wie über die rechtlichen Rahmenbedingungen für deren Einsatz. Durch Schulungen, Pressearbeit und den direkten Austausch auf unterschiedlichen Veranstaltungen unterstützen sie Unternehmen und Behörden dabei, den wachsenden Herausforderungen im Sicherheitsumfeld zu begegnen.
Ein weiterer Schwerpunkt des BVSW liegt in der Förderung von Qualifikation und Weiterbildung. Der Verband stellt ein breit gefächertes Schulungsprogramm zur Verfügung, das sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Fach- und Führungskräfte passende Angebote bietet. Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Krisenbewältigung in Unternehmen wurde das Trainingsangebot im Bereich Krisenmanagement gezielt erweitert. Ebenso zum Schulungsprogramm gehören Grundlagenkurse wie die Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach § 34a GewO oder Schulungen zur geprüften Schutz- und Sicherheitskraft (GSSK).
In Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Deggendorf hat der Verband den berufsbegleitenden Studiengang „Sicherheitsmanagement“ initiiert. Dieser Bachelorstudiengang bietet eine fundierte wissenschaftliche Grundlage für eine Karriere in der Sicherheitswirtschaft und verknüpft theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung. Auf der Messe können sich Interessierte umfassend über Inhalte, Ablauf und Zugangsvoraussetzungen des Studiums informieren.
Sie möchten die SicherheitsExpo 2025 besuchen?
Gerne laden wir Sie als unsere Gäste ein! Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Besucherticket über den BVSW. Eine kurze E-Mail an info@bvsw.de genügt – wir senden Ihnen umgehend den persönlichen Zugangslink inklusive Gratiscode zu.
Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Messestand begrüßen zu dürfen! Sie finden uns in Halle 2, Stand F 20 A und B.
Bild: Fotografie Frank Schroth
Der Operationsplan Deutschland (OPLAN) regelt die Verteidigung der Bundesrepublik im Ernstfall. Auch der Unterstützungsbedarf durch die private Wirtschaft ist darin definiert. Worauf müssen sich Unternehmen einstellen und wie können sie sich vorbereiten?
Die Sicherheitslage in Deutschland und Europa hat sich verschärft. Sollte die Situation weiter eskalieren, wäre Deutschland an der Verteidigung von NATO-Territorium beteiligt und vor allem auch logistische Drehscheibe für alliierte Streitkräfte.Die Bundeswehr hat Einzelheiten für den Ernstfall im Operationsplan Deutschland (OPLAN) festgehalten, der auch den Unterstützungsbedarf durch die private Wirtschaft umfasst.Der OPLAN wird permanent an die Sicherheitslage angepasst und ist in weiten Teilen geheim. Die Möglichkeiten der Behörden, Unterstützung durch die Privatwirtschaft anzufordern, fügen sich in den bestehenden Rechtsrahmen ein.
Welcher Ernstfall kann eintreten?
Einen „Ernstfall“ als solchen gibt es in der Gesetzgebung nicht. Vielmehr wurde er in diesem Artikel als Oberbegriff für vier mögliche Szenarien gewählt, die der Gesetzgeber genauer benennt:
Eine Vorstufe zum Verteidigungsfall ist der Spannungsfall (Artikel 80a GG). Im Gegensatz zum Verteidigungsfall wird der Spannungsfall vom Grundgesetz nicht näher beschrieben. Es könnte sich zum Beispiel um internationale Spannungen handeln, die das Potenzial haben, zu einem bewaffneten Konflikt zu eskalieren.
Der Spannungsfall erweitert die Behördenbefugnisse im geringeren Umfang als der Verteidigungsfall, doch im Rahmen der Vorsorge- und Sicherstellungsgesetze sind bereits Eingriffe möglich. Darüber hinaus können zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung die Kompetenzen der Bundeswehr ausgebaut werden. Außerdem wird die Wehrpflicht wieder aufgenommen.
Auch wenn weder ein Verteidigungs- noch ein Spannungsfall vorliegt, kann der Bundestag der Anwendung einzelner oder aller Notstandsvorschriften zustimmen (Artikel 80a GG). Ziel dieser Regelung ist es nicht, die Schwelle für Maßnahmen abzusenken, sondern dem Parlament zu ermöglichen, gezielte Verteidigungsvorbereitungen zu treffen.
Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland wurden weder der Verteidigungs- noch der Spannungsfall festgestellt. Einzig die Terroranschläge in den USA vom 11. September 2001 führten zur Feststellung des Bündnisfalls laut Nordatlantikvertrag.
Einsatz statt Büro: Auswirkungen auf den Personalbestand
Sollte einer der genannten Fälle eintreten, kann das für Unternehmen weitreichende Konsequenzen für den Personalbestand zur Folge haben. Mitarbeitende können durch gesetzliche Verpflichtungen aus ihrem regulären Arbeitsverhältnis abgezogen werden, was die Personalplanung und damit letztlich die gesamten Betriebsabläufe beeinträchtigt.
Mit dem Ausrufen des Spannungs- oder Verteidigungsfalls würde die derzeit ausgesetzte Wehrpflicht für alle männlichen Deutschen im Alter von 18 bis 60 Jahren reaktiviert. Diese könnten unmittelbar zum Wehrdienst einberufen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine sogenannte Unabkömmlichstellung erfolgen, wenn ein öffentliches Interesse an der fortgesetzten Tätigkeit im Unternehmen besteht – allerdings ohne verbindliche Leitlinien oder Rechtsmittel für Arbeitgeber.
Während des Wehrdienstes ruht das Arbeitsverhältnis ohne Entgeltzahlung, es gilt ein besonderer Kündigungsschutz. Das Arbeitsverhältnis von Zeitsoldaten ist in den ersten sechs Monaten ebenfalls geschützt, bei längerer Dienstzeit gelten Einschränkungen.
Arbeitnehmer, die im Zivil- oder Katastrophenschutz ehrenamtlich tätig sind, beispielsweise bei DRK, THW oder Feuerwehr, haben Anspruch auf bezahlte Freistellung für Einsätze, Ausbildungen und Bereitschaftsdienste. Arbeitgeber erhalten die Entgeltkosten in der Regel erstattet – beim THW jedoch erst ab bestimmten zeitlichen Ausfallgrenzen.
Im Verteidigungs- oder Spannungsfall können Arbeitnehmer zum Einsatz in verschiedenen systemrelevanten Bereichen verpflichtet werden – etwa zur Bundeswehr, in Krankenhäusern, der Energieversorgung, in Verkehrsunternehmen oder in der Lebensmittelindustrie. Diese Regelung gilt im Spannungs- oder Verteidigungsfall für Wehrpflichtige. Für Frauen kommt eine Verpflichtung nur im Verteidigungsfall infrage und ausschließlich für den Bereich Sanitäts- und Heilwesen. Ausnahmen greifen beispielsweise bei Schwangeren oder Schwerbehinderten.
Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze:
Staatliche Inanspruchnahme privater Unternehmen im Krisenfall
Im Rahmen der zivilen Verteidigung und Krisenvorsorge gibt es eine Reihe von Gesetzen, die staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft ermöglichen – teils nur im Spannungs- oder Verteidigungsfall, teils aber auch bereits zur Vorbereitung oder bei anderen Gefährdungslagen. Diese Eingriffsrechte betreffen nahezu alle Wirtschaftssektoren und können Unternehmen unter anderem verpflichten, Leistungen und Infrastruktur bereitzustellen. Allgemeine oder auch bereichsspezifische Gesetze stellen hier die Rechtsgrundlage dar.
Das Wirtschaftssicherstellungsgesetz (WiSiG) erlaubt im Spannungs- oder Verteidigungsfall planwirtschaftliche Maßnahmen durch Verordnungen der Bundesregierung etwa zur Produktionslenkung, Rohstoffverteilung oder Vorratshaltung. Auch der Finanzsektor kann betroffen sein. Die Maßnahmen reichen hier bis hin zu vorrübergehenden Börsenschließungen.
Die Inanspruchnahme von Sachen, Grundstücken, Werk- und Verkehrsleistungen ermöglicht das Bundesleistungsgesetz (BLG). Es kann unter besonderen Umständen auch außerhalb des Verteidigungsfalls gelten, wenn beispielsweise Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung bestehen.
Werden bestimmte Grundstücke zu Verteidigungszwecken benötigt, so regelt das Landesbeschaffungsgesetz (LBG) deren Erwerb oder Enteignung. Nutzungseinschränkungen für Grundstücke, die in unmittelbarer Nähe von Verteidigungseinrichtungen stehen, können im Rahmen des Schutzbereichsgesetz (SchBerG) erlassen werden.
Regelungen für einzelne Wirtschaftsbereiche
Neben den genannten Gesetzen gibt es noch weitere Regelungen für bestimmte Wirtschaftsbereiche.
So greift bei akuter Störung oder Gefährdung der Energieversorgung das Energiesicherungsgesetz (EnSiG) und zwar unabhängig vom Verteidigungsfall. Es erlaubt umfassende Eingriffe in Produktion, Verteilung, Lagerung und Preisbildung sämtlicher Energieträger. Für Betreiber Kritischer Infrastrukturen gemäß BSI-KritisV sind weitergehende Maßnahmen wie Treuhandverwaltung oder Enteignung möglich.
Das Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz (ESVG) ermächtigt die Bundesregierung zur Feststellung einer Versorgungskrise, beispielsweise bei Naturkatastrophen oder militärischen Konflikten. In Folge können Maßnahmen zur Steuerung der Lebensmittelproduktion und -verteilung, einschließlich Zuteilungen („Lebensmittelmarken“), angeordnet werden.
Auch die Wasserversorgung muss im Fall einer Krise aufrechterhalten bleiben. Maßnahmen, die für die Sicherstellung von Wasserversorgung- und -entsorgung erlassen werden können, regelt das Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG). So erlaubt es beispielsweise, Unternehmen zum Bau von Eigenbrunnen zu verpflichten.
Das Postsicherstellungsgesetz (PSG) fordert von Postunternehmen die Priorisierung sogenannter „Postbevorrechtigter“, beispielsweise Behörden, Gesundheitswesen oder Bundeswehr bei Störungen. Etwas Vergleichbares gilt für Telekommunikationsanbieter und ist im Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt. Im PSG ist darüber hinaus auch im Kriegsfall die Unterstützung der Feldpost durch private Postunternehmen festgelegt.
Nicht zuletzt ist die Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur im Krisenfall wichtig. Hier greift das Verkehrssicherstellungsgesetz (VerkSiG). Es dient der Aufrechterhaltung und Steuerung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln zu Zwecken der Verteidigung. Dennoch ist es nicht zwingend an den Eintritt eines Spannungs- oder Verteidigungsfalls gebunden, sondern ermöglicht auch präventive Maßnahmen bei anderen sicherheitsrelevanten Lagen.
Resilienz durch vorausschauende Vorbereitung
Die Vielzahl an Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen zeigt, wie breit und tiefgreifend der Staat im Krisen- oder Verteidigungsfall, aber auch bereits im Vorfeld, auf privatwirtschaftliche Ressourcen zugreifen kann. Für Unternehmen bedeutet das, dass Vorsorge keine freiwillige Option ist, sondern vielmehr ein strategischer Bestandteil betrieblicher Resilienz.
Unternehmen sollten klären, welche Gesetze im Krisenfall greifen würden. Auch die Vertragsgestaltung muss auf ihre Krisenfestigkeit überprüft werden, beispielsweise welche Konsequenzen die staatliche Inanspruchnahme auf die Lieferverpflichtungen hätte. Sinnvoll ist auch eine Dokumentation aller betrieblicher Ressourcen, die eventuell bei einer Krisenlage eingefordert werden könnten. Die mögliche staatliche Inanspruchnahme sollte in den bestehenden Krisenplänen Berücksichtigung finden.
Ein guter Kontakt zu den relevanten Behörden kann hilfreich sein. Verantwortliche sollten daher die jeweiligen Anforderungsbehörden identifizieren und mit den zuständigen Stellen in Verbindung treten. Im Ernstfall können Informationsabfragen zu Verfügbarkeiten und Kapazitäten recht kurzfristig eintreffen. Die entsprechenden Daten sollten deshalb vorbereitet und stets aktuell gehalten werden.
Weitere Informationen beim BVSW
Der Bayerische Verband für Sicherheit in der Wirtschaft plant derzeit eine eigene Fachveranstaltung zum Thema „OPLAN – Operationsplan Deutschland“. Ziel ist es, Unternehmen, Behörden und Sicherheitsexperten eine Plattform für den Austausch zu bieten – insbesondere zu Fragen der operativen Planung, nationalen Sicherheitsstrategien und deren praktischer Umsetzung. Weitere Informationen zur Veranstaltung, einschließlich Termin und Programm, werden in Kürze bekannt gegeben.
München, 23.04.2205: Ein branchenübergreifendes Pilotprojekt untersucht erstmals systematisch Drohnenüberflüge über KRITIS-Liegenschaften im Süden Wiens – mit klaren Ergebnissen zur Bedrohungslage und einem neu entwickelten Drohnengefährdungsindex.
Drohnenüberflüge über sensible Unternehmensareale stellen eine zunehmende Herausforderung dar – insbesondere dann, wenn es sich um kritische Infrastrukturen (KRITIS) handelt. Während sich Expertinnen und Experten aus der Sicherheitsbranche seit geraumer Zeit über mögliche Schutzmaßnahmen zur Drohnendetektion und -abwehr austauschen, entstehen aktuell innovative Lösungsansätze durch branchenübergreifende Kooperationen.
Ein herausragendes Beispiel für einen solchen Zusammenschluss wird im Rahmen der diesjährigen BVSW SecTec präsentiert.
Unter dem Titel „Erfolgreiche Detektion von Selbstbau- und kommerziellen Drohnen im Projekt DIANA: Erkenntnisse und Erfahrungen aus Wien“ präsentieren Dipl.-Ing. Dr. Josef Bogensperger VERBUND AG Wien (angefragt) und Markus Piendl, Sachverständiger für Sicherheitstechnik, erstmals bislang nicht veröffentlichte Erkenntnisse aus dem Projekt.
In ihrem Vortrag berichten Dr. Bogensperger und Herr Piendl über das Projekt DIANA, das unter aktiver Mitwirkung von sechs führenden österreichischen Industrieunternehmen sowie der VERBUND AG und Telekom-Tochter Detecon International GmbH durchgeführt wurde. Ziel der dreimonatigen Erhebung war es, systematisch zu analysieren, ob, wann und wie häufig im Süden Wiens kommerzielle sowie selbstgebaute Drohnen über KRITIS-Liegenschaften geflogen werden.
Im Rahmen der BVSW SecTec wird die freigegebene Abschlusspräsentation des Projekts erstmals öffentlich vorgestellt – mit verblüffenden Ergebnissen sowie einem Ausblick auf das weitere Vorgehen. Dienststellen der Polizei und der Streitkräfte im In- und Ausland haben die Präsentation aufgrund der einfach verständlichen, präzisen Visualisierung der verwendeten Datenbank sowie den Schlussfolgerungen u.a. zu einem Drohnengefähdungsindex besonders gelobt.
Mit dem Projekt DIANA zeigt sich, was durch kooperative Innovationskraft möglich ist – ein neuer Standard im Schutz kritischer Infrastrukturen nimmt Gestalt an.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Bitte beachten Sie, dass Audio- und Videoaufzeichnungen während des Vortrags ausdrücklich untersagt sind.
Das vollständige Programm der BVSW SecTec sowie Details zu Ort, Zeit und weiteren Vortragenden finden Sie auf der offiziellen Website unter Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Aufgrund des großen Interesses empfehlen wir eine frühzeitige Registrierung.
Bildquelle: Shutterstock – Symbolbild eines kritischen Infrastrukturbereichs (KRITIS)
BVSW SecTec vom 5.-6. Juni in München
Technische Innovationen kommen in immer kürzeren Abständen auf den Markt und bieten neue Möglichkeiten für die Sicherheit. Die wichtigsten Trends werden diesen Sommer wieder auf der BVSW SecTec 2025 vorgestellt. Ernst Steuger, BVSW Vorstand und Geschäftsführer der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, gibt einen Überblick, was die Besucher erwartet.
„Technik spielt in der Sicherheit eine immer wichtigere Rolle. Mit der BVSW SecTec wollen wir Unternehmen eine Orientierung bieten, welche Technologien das Potenzial haben, die Sicherheit zu verbessern und effizienter zu gestalten“, sagt Ernst Steuger.
Kollege Roboter kommt
Der Fachkräftemangel ist in der Sicherheitsbranche nach wie vor ein heikles Thema. Die Entwicklungen in der Robotik können helfen, das Problem in einigen Bereichen zu entschärfen. Insbesondere bei der Überwachung von großen Arealen erweisen sich Roboter schon heute als besonders hilfreich. „Einige Außengelände beispielsweise umfassen 15 bis 40 Kilometer Zaun“, so Steuger. „Auf einem so großen Gebiet ist die Überwachung mithilfe von Kameras aufwändig, beginnend von den Erdarbeiten und der Verlegung von Anschlusskabeln bis hin zur Wartung der Geräte.“ Ein Roboter hingegen, der mit Kameras ausgestattet ist, kann die Außengrenzen des Geländes abfahren. Was am besten und wirtschaftlichsten ist, hängt immer vom Schutzziel im Einzelfall ab. Sollte die Kamera eine Unregelmäßigkeit erfassen, beispielsweise einen beschädigten Zaun, wird das Bild an die Alarmempfangsstelle gesendet. Ein Mitarbeiter hat dann die Möglichkeit, sich auf die Kamera aufzuschalten, um sich die Situation genauer anzusehen und weitere Schritte einzuleiten.
Nicht nur im Außenbereich sind die Roboter eine große Hilfe: In Lagerhallen und Logistikzentren werden laufend Waren bewegt, so dass der Sichtbereich von fest installierten Kameras gelegentlich eingeschränkt sein kann. Roboter können auch in solchen Einsatzszenarien für Sicherheit sorgen und Mitarbeiter aus der Zentrale bei Bedarf mit auf einen virtuellen Rundgang nehmen. Große Fortschritte gibt es aktuell auch im Bereich der humanoiden Roboter, die ein noch breiteres Aufgabenspektrum abdecken können. „Diese Roboter sind in der Lage, Kontrollgänge in Bürogebäuden durchzuführen und eventuell offen gelassene Fenster zu schließen oder vergessene Kaffeemaschinen auszuschalten.“
Auch Drohnen sind mittlerweile in der Sicherheit nicht mehr wegzudenken und kommen gerade bei der Überwachung von Außenflächen zum Einsatz. In Zusammenarbeit mit Robotern lässt sich das Leistungsspektrum von beiden Technologien erweitern: „Angenommen ein Roboter entdeckt eine Beschädigung am Zaun, dann kann die Drohne Personen auf dem Gelände lokalisieren, die sich eventuell Zutritt verschafft haben“, so Steuger.
LiDAR-Systeme: Licht ins Dunkel
Eine Möglichkeit, sein Umfeld zu überwachen, bietet die LiDAR-Technologie (Light Detection And Ranging). Dabei tasten Laserstrahlen die Umgebung ab und können so sehr genaue Abbilder von Gegenständen, Tieren und Personen erstellen. Ein wesentlicher Pluspunkt gegenüber bildgebenden Technologien ist der Datenschutz: „Ein LiDAR-Sensor erfasst die Umrisse und kann somit Personen detektieren, nicht aber deren Gesicht erkennen und wird somit strengen Vorgaben zum Datenschutz gerecht.“ Außerdem liefern LiDAR-Systeme zuverlässige Überwachungsdaten unabhängig von Wetter oder Tageszeiten.
Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch
Die Verknüpfung von Technologien bietet in unterschiedlichen Bereichen immer leistungsstärkere Gesamtsysteme und in viele Lösungen wird Künstliche Intelligenz integriert. Mittels künstlicher Intelligenz lassen sich die biometrischen Merkmale in Gesichtern vermessen, also beispielsweise der Abstand der Augen oder die Länge der Nase. Anhand dieser Merkmale ist KI in der Lage, Gesichter wiederzuerkennen, ohne sie bildlich darzustellen. Auch hier lassen sich die Vorgaben zum Datenschutz einhalten. Mit entsprechender Software für Kameras, bietet KI damit entscheidende Vorteile beispielsweise bei der Überwachung von Supermärkten und anderen öffentlich zugänglichen Räumen: Wird eine Person erkannt, die Hausverbot hat, wird sie auf den Bildern der Überwachungskameras markiert. Der Sicherheitsdienst kann den Weg der Person nachverfolgen, um weitere Maßnahmen einzuleiten.
Smarte Zutrittssysteme
Zutrittssysteme regeln heute weit mehr als nur den Einlass. Mittlerweile gibt es Lösungen, die sich zusätzlich als Lotsendienste zur Navigation durch Firmengebäude und Werksgelände einsetzen lassen. Dafür brauchen Besucher ihr Smartphone, auf dem sie die Ortungsdienste angeschaltet lassen müssen. Nach dem Zutritt bekommen sie eine Wegbeschreibung vorgezeichnet, die sie zu ihrem Ziel führt. Mittels Geofencing wird dafür gesorgt, dass die Besucher die vorgegebene Route nicht verlassen. „Sobald ein Besucher einen bestimmten Bereich verlässt, ertönt ein Alarm auf seinem Handy und gleichzeitig wird der Sicherheitsdienst oder Gastgeber alarmiert. Sollte der Besucher die vorgegebene Route nicht wieder einnehmen, kann ein Mitarbeiter einschreiten“, so Steuger.
Hohe Anforderungen an Errichter
Die Möglichkeiten der Sicherheitstechnik wachsen schnell. Errichter spielen vor diesem Hintergrund eine Schlüsselrolle: Sie müssen die Integration unterschiedlicher Technologien meistern. Statt einzelnen Systemen sind zukünftig immer öfter komplexe, vernetzte Lösungen gefragt, die miteinander kommunizieren. „Die Herausforderung liegt darin, die richtige Kombination aus Hard- und Software zu finden und dabei die individuellen Anforderungen der Auftraggeber sowie die gesetzlichen Vorschiften zu berücksichtigen“, erklärt Steuger. Aspekte wie Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ebenso wichtig ist die regelmäßige Wartung und Aktualisierung der Systeme, um mit den neuesten technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Letztlich sind Errichter nicht nur technische Dienstleister, sondern strategische Partner für Unternehmen, die ihre Sicherheitsinfrastruktur zukunftssicher gestalten wollen.
Infos rund um diese Trends werden auf der diesjährigen BVSW SecTec präsentiert, die am 5. und 6. Juni in München stattfindet. Die Anmeldung ist möglich unter: bvsw.de
Am 5. und 6. Juni 2025 findet im NH München Ost Conference Center die nächste Ausgabe der BVSW SecTec statt. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren als fester Termin für Fach- und Führungskräfte der Sicherheitsbranche etabliert und bietet auch 2025 wieder ein hochkarätiges Programm rund um aktuelle Entwicklungen, Innovationen und Herausforderungen in der Sicherheitstechnologie.
Die SecTec richtet sich an Expertinnen und Experten aus Unternehmenssicherheit, IT- und Cybersecurity, Technik, Planung und Einkauf sowie KRITIS-Unternehmen. Ziel ist es, den Austausch über zukunftsorientierte Sicherheitslösungen und Best Practices zu fördern – praxisnah, interdisziplinär und technologieoffen.
Das Fachprogramm beleuchtet zentrale Trends und Technologien der Sicherheitsbranche. Unter anderem stehen folgende Themen auf der Agenda:
Die BVSW SecTec 2025 findet erneut im Lunch-to-Lunch-Format statt. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Teilnehmende einen kompakten Überblick über aktuelle Themen und Trends – ergänzt durch zahlreiche Networking-Gelegenheiten. Eine begleitende Abendveranstaltung am ersten Kongresstag schafft zusätzlich Raum für persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre.
Eine interaktive Fachausstellung bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Lösungen einem interessierten Fachpublikum zu präsentieren. Ergänzend dazu stellen sich alle Aussteller in kurzen Elevator Pitches dem Plenum vor – ein bewährtes Format zur kompakten Präsentation von Produkten und Services.
Die Anmeldung für Teilnehmer und Aussteller ist ab sofort über die Website des BVSW freigeschaltet. Die Plätze sind begrenzt – eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.
Autokratien sind auf dem Vormarsch, Tech-Konzerne weiten ihren Einfluss aus, Künstliche Intelligenz hält Einzug in die unterschiedlichsten Lebensbereiche und Europa muss seine Rolle in der Welt festigen. Wie verschieben sich damit Grenzen der Sicherheit? Antworten auf diese und viele weitere Fragen lieferte BVSW Wintertagung vom 12. bis 14. März 2025.
„Wir freuen uns, dass Sie wieder so zahlreich unserer Einladung zur Wintertagung gefolgt sind. Das ist für uns die beste Bestätigung, wie sehr dieses Format von der Sicherheitsbranche geschätzt wird“, begrüßten BVSW-Geschäftsführerin Caroline Eder und der Vorstandsvorsitzende Johannes Strümpfel die über 150 Teilnehmenden. Die Veranstaltung im Arabella Alpenhotel am bayerischen Spitzingsee war ein weiteres Jahr in Folge restlos ausgebucht. „Mittlerweile hat sich die BVSW Wintertagung als fester Termin für Sicherheitsexperten etabliert, die sich über aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der Sicherheit informieren und dabei auch über den Tellerrand des eigenen Fachgebietes hinausschauen wollen.“
Eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde läutete die BVSW Wintertagung am Mittwochabend ein: Michael Schwald, Landespolizeipräsident Bayern, Michael George, Leiter des Cyber-Allianz-Zentrums Bayern im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, und Johannes Strümpfel, stellvertretender Sicherheitschef der Siemens AG, beleuchteten die aktuellen Themen der Inneren Sicherheit und die Folgen für die Sicherheitsabteilungen sowie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Sicherheitsbehörden.
Trumps zweite Amtszeit und ihre Bedeutung für Europa
Der zweite Tag startete mit dem Vortrag von Prof. Dr. em. Günther Schmid. Sein mit Spannung erwarteter Beitrag befasste sich mit der zweiten Amtszeit Donald Trumps und den sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Folgen für Deutschland und Europa.
Dass die positive wirtschaftliche Entwicklung in den USA für weite Teile der Bevölkerung nicht spürbar wurde, war laut Schmid der wesentliche Grund für die Wiederwahl Trumps. Die Demokraten hatten keine Antworten gefunden auf die steigende Inflation und die hohen Preise auf dem Wohnungsmarkt. Trumps Wahlsieg markiert indes das Ende der transatlantischen Epoche, der Grundlage deutscher Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten. Er verfolgt eine Politik der nationalen Interessen, die multilaterale Strukturen schwächt. Während die USA sich zurückziehen, könnte China global an Einfluss gewinnen. Eine weltweite Anti-Trump-Allianz sei nicht zu erwarten – stattdessen könnten andere Länder seiner Politik folgen.
Für Deutschland bedeutet dies: Es muss seine Abhängigkeiten verringern, eigene Interessen klarer formulieren und Europa sowie die europäische Säule in der NATO stärken.
Neue Spannungsfelder: Weltraum, digitale Infrastruktur und KI
Nationale Interessen spielen nicht nur auf der Erde eine immer wichtigere Rolle, sondern auch im Weltraum. Trotz seiner scheinbaren Unendlichkeit ist der für den Menschen nutzbare Platz dort durchaus begrenzt, was zu einer steigenden geopolitischen Rivalität führt, erklärte Andrea Rotter, Referatsleiterin für Außen- und Sicherheitspolitik an der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung. Der Weltraum ist für viele Services auf der Erde wichtig, sei es für Navigationssysteme oder die Finanzwirtschaft. Aber auch zukünftige Technologien wie das autonome Fahren sind auf Satelliten im All angewiesen. Neben staatlichen Akteuren versuchen immer häufiger auch private Unternehmen, sich einen strategisch günstigen Platz im Weltraum zu sichern.
Vom Weltraum in die Weltmeere führte der Vortrag von Oliver Rolofs, Berater für strategische und politische Kommunikation. In seinem Beitrag ging es um Seekabel, eine unsichtbare, aber entscheidende Infrastruktur für die digitalisierte Wirtschaft, die in jüngster Zeit immer wieder durch Sabotageakte in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt ist. Neben der Bedrohung durch Angriffe sorgt die zunehmende Dominanz der großen Technologiekonzerne Meta, Apple, Microsoft, Google und Amazon auch in diesem Sektor für eine wachsende Machtkonzentration in den Händen privater Akteure. Eine stärkere Kontrolle der privaten Betreiber und bessere Sicherheitskonzepte über und unter Wasser gewinnen daher an Bedeutung.
Seekabel sind wichtige Datenautobahnen für einen Technologietrend, der derzeit in aller Munde ist: Künstliche Intelligenz ist für sehr viele Anwendungsbereiche hilfreich, kann aber in falschen Händen genauso gut zur strategischen Waffe werden. Das zeigte eindrucksvoll der Vortrag von Boris Bärmichl, Technologiescout und Vorstand der Digitalsparte beim BVSW. Bärmichl bewertete den EU Artificial Intelligence Act als wichtigen Schritt in die richtige Richtung, um Missbrauch zu verhindern.
Dr. Holtherm, Generalstabsarzt und Leiter der Task Force Medizinischer ABC-Schutz, lenkte den Fokus auf die Bedrohungen durch atomare, biologische und chemische (ABC) Kampfstoffe. Als besorgniserregend bewertete Dr. Holtherm die neue Bedrohung durch Drohnen, die diese Kampfstoffe über größere Distanzen transportieren können. Künstliche Intelligenz spielt auch in seinem Fachgebiet eine wachsende Rolle und zeichnet sich durch einen problematischen „Dual Use“ aus. So lässt sich Künstliche Intelligenz einsetzen, um die Heilung von Krankheiten zu erforschen, aber auch, um beispielsweise resistente Bakterien zu entwickeln. Dr. Holtherm betonte daher die Notwendigkeit klarer rechtlicher Regeln, um den Missbrauch dieser Technologie zu verhindern.
Von Physik und Mimik
Zum Auftakt des letzten Kongresstags nahm Prof. Dr. Metin Tolan die Teilnehmenden mit auf eine physikalische Mission ins James Bond-Universum. In einem äußerst kurzweiligen Beitrag überprüfte der Physiker die technischen Spielereien des legendären Doppelnullagenten auf ihre Plausibilität. Rasante Verfolgungsjagden, Spiegelungen oder ein Lauf über Krokodilrücken, nicht alles hält den Gesetzen der Physik stand. Und auch die Frage, warum Bond seinen Martini immer geschüttelt trinkt und nicht gerührt, wurde geklärt. Die Antwort liegt, wer hätte es gedacht, in der Physik.
Von der Welt des Filmes zurück in die Realität der Verhandlungen und Verhöre führte der Beitrag von Sabrina Rizzo. Die Polizeicoachin und Expertin für nonverbale Kommunikation gab einen Einblick in ihr Rizzo-Konzept. Sie zeigte, wie Mimik, Gestik und Körpersprache Hinweise auf innere Zustände und mögliche Täuschungsversuche geben. Anhand realer Kriminalfälle – darunter Amanda Knox und der Mord am russischen Botschafter Andrej Karlow – demonstrierte sie, welche mimischen Signale auf Ungereimtheiten hinweisen können. Ihr Vortrag verdeutlichte, dass Verhandlungen und Befragungen weit mehr sind als das gesprochene Wort: Wer Körpersprache richtig deutet, hat einen entscheidenden Vorteil.
Karriere und Weiterbildung in der Sicherheit
Auch das Thema Karriere in der Sicherheitsbranche hat auf der BVSW Wintertagung seinen festen Platz. Der BVSW engagiert sich stark im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften in der Sicherheit, damit der steigende Bedarf an qualifizierten Experten auch zukünftig gedeckt ist.
Ein Beispiel für die vielfältigen Karrierewege lieferte Sebastian Reis. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr führte ihn sein Werdegang über verschiedene Stationen in der zivilen Sicherheit bis hin zu seiner heutigen Position als Manager Corporate Security bei Quantum Systems. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg war das berufsbegleitende MBA-Studium „Strategy, Global Risk & Security Management“ an der Technischen Hochschule Ingolstadt – ein Studiengang, für den der BVSW bereits seit sechs Jahren die Schirmherrschaft übernimmt.
Wer eine erste akademische Qualifikation im Sicherheitsmanagement anstrebt, kann den vom BVSW initiierten Bachelorstudiengang an der Technischen Hochschule Deggendorf absolvieren. Vertreter beider Hochschulen stellten im Anschluss die Studiengänge vor.
Blick in die Zukunft
Den Abschluss der Wintertagung bildete, wie jedes Jahr, der Vortrag von Dr. Benedikt Franke, dem stellvertretenden Vorsitzenden und CEO der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Er gab exklusive Einblicke in die wichtigsten Momente der diesjährigen MSC, von der vielen vor allem die denkwürdige Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance in Erinnerung geblieben war. In ihr sieht Franke Teil einer neuen Strategie der USA, die übrigens mit der größten Delegation jemals zur MSC erschienen war, die Europäer zur Steigerung ihrer Verteidigungsausgaben zu zwingen. Eine Strategie, die nach derzeitigen Erkenntnissen aufzugehen scheint.
Insgesamt wurde die diesjährige Wintertagung von den Teilnehmenden als sehr positiv bewertet und viele planen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Bereits jetzt ist die 14. Wintertagung in Vorbereitung, die vom 11. bis 13. März 2026 stattfinden wird. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.bvsw.de
Ab dem 1. Juli 2025 wird die Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe nach § 34a GewO nach einem neuen Bewertungsverfahren durchgeführt. Dies bedeutet eine wesentliche Änderung in der Punktevergabe:
🔹 Teilrichtige Antworten werden künftig berücksichtigt!
Bisher gab es nur dann Punkte, wenn alle richtigen Lösungen einer Aufgabe vollständig erkannt und markiert wurden. Ab Juli 2025 gilt ein differenzierteres System:
✔ Für jede richtige Lösung gibt es nun einen Punkt.
✔ Eine Aufgabe mit zwei richtigen Antworten bringt also zwei Punkte, wenn beide erkannt wurden. Wird nur eine richtige Lösung markiert, gibt es dafür einen Punkt.
🔹 Neue Maximalpunktzahl & Bestehensgrenze
Mit dieser Anpassung steigt die maximal erreichbare Punktzahl von 100 auf 120. Die Bestehensgrenze bleibt jedoch bei 50 %, also künftig 60 Punkte.
🔹 Aktualisierte Lehrmaterialien
Die Lehrmaterialien, die der BVSW von der SecuMedia Verlags GmbH bezieht, werden rechtzeitig an das neue Bewertungssystem angepasst.
Eine detaillierte Gegenüberstellung des alten und neuen Bewertungsverfahrens finden Sie hier zum download